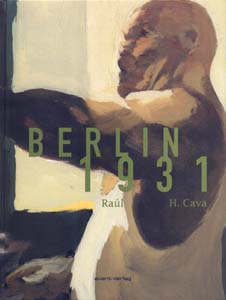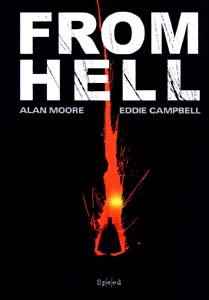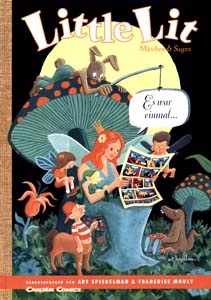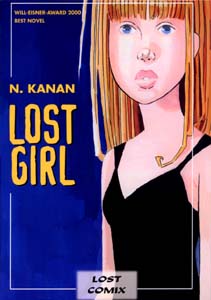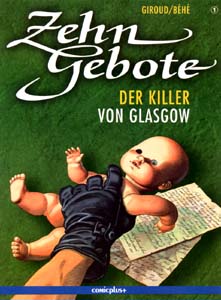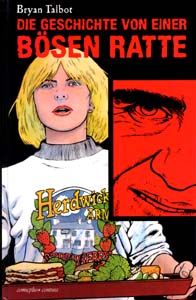|

|
| Kategorie
3b |
| Beste
deutschsprachige Comic-Publikation, Import |
Raúl/Felipe H. Cava, "Berlin 1931",
Avant-Verlag
Hinter dem Titel "Berlin 1931" verbergen
sich drei lose miteinander verbundene Geschichten, die zur selben Zeit
am selben Ort spielen. 1931 herrschen in Deutschland Arbeitslosigkeit
und Fremdenfeindlichkeit. Eine Gruppe junger Kommunisten, die sich auf
den Bürgerkrieg vorbereitet, erwartet einen - scheinbar - verbündeten
Waffenhändler aus Hamburg. Doch das gegenseitige Misstrauen ist
groß, und so entwickelt sich hinter dem politischen Engagement
ein Kaleidoskop aus persönlichen Intrigen und sehr menschlichen
Gefühlen. Die Hauptgeschichte "Die Reise nach Swinemünde"
wird vor allem durch die Herausforderung interessant, die der Autor
Felipe H. Cava dem Leser zumutet. Er präsentiert einen zeitlich
und thematisch sehr eng gefassten Abschnitt aus dem Leben der Protagonisten,
sodass alles im Dunkeln bleibt, was man sich nicht selbst erschließen
kann. Mit dieser geheimnisvollen Atmosphäre harmonieren Raúls
Zeichnungen ganz hervorragend. Düstere, oft schattenhafte Umrisse,
verschwommene Gesichter und das Ineinanderfließen von Tag und
Nacht lassen der Fantasie des Lesers viel Spielraum. Flankiert wird
"Die Reise nach Swinemünde" von zwei kürzeren Erzählungen,
die wie flüchtige Momentaufnahmen die Atmosphäre jener Zeit
einfangen. Karikaturistisch verfremdet die eine und collageartig opulent
die andere, zeugen sie von der außerordentlichen Vielfalt des
Zeichner-Autoren-Teams. (pela)
|
|
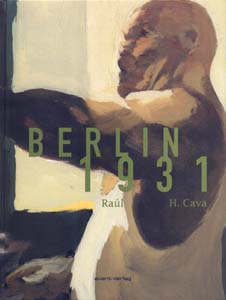 |
Alan Moore/Eddie Campbell,
"From Hell", Speed
Alan Moore ist ein
Comic-Autor, der eigentlich nicht unbedingt einen Zeichner benötigt.
Mit anderen Worten "From Hell" hätte auch als Hörspiel
oder Roman funktioniert, ohne dass man Wesentliches daran hätte
ändern müssen. Zum Glück für die internationale
Comic-Szene versteht Alan Moore sich selber aber nicht als Roman- sondern
eben als Comic-Autor, so dass seine literarischen Perlen ein nach wie
vor oft zu unrecht als trivial gescholtenes Medium immer wieder zu veredeln
wissen. Und natürlich: auch "seine" Zeichner, die Alan
Moore stets mit viel Geschick für das aktuelle Projekt wählt,
tragen ein Gehöriges zu diesen Meisterwerken der grafischen Literatur
bei. In "From Hell" machen erst Eddie Campbells holzschnittartige
Zeichnungen das viktorianische Dekor dieser dunklen Saga, Freimaurer,
Royalisten und Straßenhuren (besser: Menschen) im London des Jahres
1888 so richtig spür- und erlebbar. Ach ja, natürlich geht
es auch um "Jack the Ripper", dessen Morde und mehr oder weniger
dessen Entlarvung. Aber das vergisst man als faszinierter Leser gerne,
während Moore und Campbell einem das Mystische an London so hautnah
näher bringen wie vielleicht gerade Altmeister Hugo Pratt in "Corto
Maltese" weiland das Mystische an (unter anderem) Venedig. Auch
die 56-seitigen Anmerkungen in diesem "600-seitigen Monster"
(The Guardian) sind Zeile für Zeile lesenswert und beweisen nicht
zuletzt, dass man auch perfekte eigenständige Kunstwerke schaffen
kann, wenn man fast ausschließlich wörtlich von wahren und
belegten historischen Fakten (besser: vom wirklichen Leben) abschreibt.
(hah)
|
|
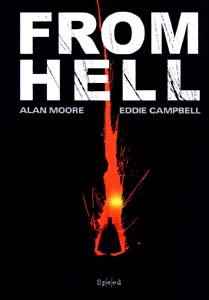 |
Art
Spiegelman/Françoise Mouly, "Little Lit", Carlsen Comics
Sprach man in den letzten
Jahren Art Spiegelman auf sein Magazin "Raw" an, huschte ein
versonnenes Lächeln über sein Gesicht. "'Raw' ist nicht
tot", antwortete er dann, "es liegt nur im Tiefkühlfach."
Und meistens fügte der Vater von "Maus" hinzu, dass ja
alle Künstler, die seinerzeit in "Raw" veröffentlichten,
inzwischen von seiner Frau Françoise Mouly im "New Yorker"
untergebracht wurden: "Also ist der ‚New Yorker' das neue
‚Raw', die wissen es nur nicht." Jetzt hat Spiegelman sein
Kultmagazin anscheinend aufgetaut, denn mit "Little Lit - Märchen
und Sagen" ist ein Band erschienen, der fast all die alten Mitstreiter
des "Raw"-Magazins zwischen zwei Hardcovern versammelt. Und
wie schon bei der unvergessenen Heftreihe galt auch hier nur ein Kriterium:
Die besten Comiczeichner und -erzähler der Welt sollen präsentiert
werden. Und so liest sich die Liste der Mitwirkenden dann auch wie ein
internationales "Who-is-Who" der aktuellen Comicszene: Daniel
Clowes, Joost Swarte, David Mazzucchelli, Lorenzo Mattotti, Charles
Burns und viele andere mehr haben sich traditioneller Märchenstoffe
angenommen und spinnen daraus ihr eigenes Garn. Dazwischen ist dann
auch mal Platz für einen Klassiker wie Walt "Pogo" Kelly,
der sich wunderbar in die Riege der modernen Künstler einfügt.
Das ist, wie bei Anthologien üblich, nicht immer ganz gelungen,
aber die bibliophile Aufmachung des großformatigen Bandes - die
auch ein von Chris Ware gestaltetes Würfelspiel beinhaltet - rettet
selbst die wenigen nur mittelprächtigen Geschichten. In den USA
liegt bereits ein zweiter Band vor, diesmal mit klassischen Gruselgeschichten.
(LuG)
|
|
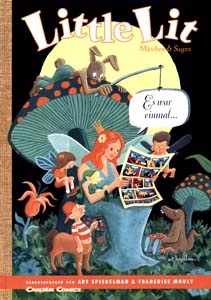 |
Nabiel Kanan, "Lost
Girl", Lost Comix
Die Pubertät ist
eine Zeit der Melancholie, der Fantasie, der Sehnsüchte, der Träume.
In der Erinnerung wird sie so durchsichtig wie die Zeichnungen in Nabiel
Kanans grafischer Pubertätsnovelle "Lost Girl". "Lost
Girl" ist eine Feriengeschichte, die Geschichte einer Begegnung
zweier junger Mädchen. Das eine macht mit seinen bürgerlichen
Eltern Urlaub auf einem Caravan-Platz. Das andere taucht auf, nimmt
sich Freiheiten, hat Geheimnisse, lügt, verschwindet, ist faszinierend
für das Bürgerkind. Der 31-jährige Engländer Nabiel
Kanan erzählt die Geschichte in Schwarzweiß, mit holzschnitthaft
kargen Strichen, ohne viele Worte. Hier kommt es ganz auf Atmosphäre
an, auf diese erwartungsvolle Stille in den Seelen, die grafisch wundervoll
erzeugt wird. "Lost Girl" hat die Qualität der Ruhe,
der Kontemplation, eines verträumten Blicks aus der Rückenlage
zum Himmel oder eines berauschenden Ritts zu zweit auf dem Rücken
eines Pferdes (zwei subjektive Eindrücke, die bei Kanan Bild werden).
Insofern ist "Lost Girl" eine wohltuende Alternative zum dramaturgischen
und grafischen Überdruck vieler Konsum-Comics. Dass die deutsche
Ausgabe im On-Demand-Verfahren entstanden ist und neue Vertriebswege
für anspruchsvolle Comic-Literatur eröffnet, ist interessant,
doch für das ästhetische Urteil spielt das verlegerische Unterfangen
keine Rolle. (HH)
|
|
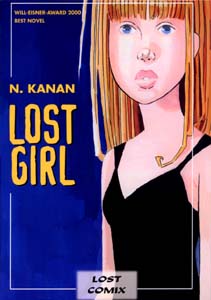 |
Frank Giroud, "Zehn Gebote", Comicplus+
Es gibt Glücksfälle im Verlagsgewerbe. Einer davon ist
die französische Serie "Zehn Gebote", deren erste drei
Titel mittlerweile auch auf Deutsch erschienen sind - und das jeweils
kurz nach den Originalausgaben. Als Frank Giroud seine Serie vor zwei
Jahren begann, wird er nicht geahnt haben, welche Aktualität sein
Szenario über die zehn verlorenen Gebote des Propheten Mohammed
durch die Anschläge vom 11. September 2001 erhalten würde.
Der zweite Band etwa, "Eine Frage des Gewissens", gezeichnet
von Giulio De Vita, widmet sich einem fanatischen Attentäter, der
einen liberalen muslimischen Schriftsteller verfolgt: "Höre
in deinem Herzen die Stimme Gottes" lautet das Gebot, das dieser
Geschichte ihren Kern gibt, denn sämtliche Alben widmen sich jeweils
einem der zehn fiktiven Gebote. Alle Folgen sind jedoch in sich abgeschlossen,
und jedes einzelne Album wird - ein revolutionäres Konzept - von
einem jeweils anderen Zeichner umgesetzt werden. Die ersten beiden haben
ihre Handlungszeit in der Gegenwart, der dritte mit dem Titel "Die
Ikone in Tränen" führt erstmals in die Vergangenheit,
ins noch von Krieg und Partisanenkampf zerrüttete Griechenland
der 50er Jahre. Die einzige inhaltliche Klammer der Reihe besteht im
Erzählhintergrund: Alle zehn Teile des Zyklus berichten von den
Bemühungen wechselnder Protagonisten, einen Roman namens "Nahik"
zu finden, in dem ein napoleonischer Offizier die von ihm aufgefundenen
zehn Gebote Mohammeds aufgelistet hat. Für dieses Buch wird gemordet,
betrogen, gestohlen und geliebt. Und alle zehn Alben werden die jeweils
darin behandelten Gebote zum Thema einer narrativen Auseinandersetzung
zwischen den Religionen und individuellen Lebensentwürfen der Suchenden
machen. Ein ambitionierteres Projekt ist schwer vorstellbar. (apl)
|
|
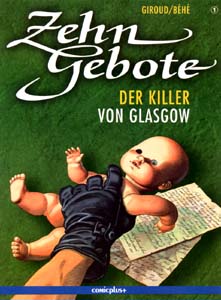 |
Bryan Talbot, "Die Geschichte von einer bösen Ratte",
Comicplus+
Helen ist ein Punk. Eine von der Sorte, die auf der Straße
lebt und bettelt, in U-Bahnschächten Zuflucht sucht und als Haustier
eine Ratte hält. Jetzt lebt sie in London in einem besetzten Haus
und hat schwere Probleme, sich auf andere Menschen einzulassen. Sie
flieht aus der großen Stadt und sucht Zuflucht auf dem Land, im
nordenglischen Lake District. Erst hier konfrontiert sie sich selber
mit dem Horror, der in ihrer eigenen Seele lebt: Jahrelang musste das
Mädchen den sexuellen Missbrauch durch den eigenen Vater ertragen.
Nur sehr langsam lernt sie, dass es Menschen gibt, denen sie vertrauen
kann, gleichzeitig erlebt sie ihr Coming Out als Künstlerin. Helen
arrangiert ein Treffen mit ihrem Folterer und diese Katharsis befreit
sie endgültig von ihrer Vergangenheit.
Der britische Zeichner und Autor Bryan Talbot liefert mit diesem Buch
ein kleines Meisterstück ab: Seine Geschichte einer bösen
Ratte geht mit dem Thema Kindesmissbrauch auf eine sehr persönliche,
fast schon intime Art um. Nicht dass er Mitleid oder gar Verständnis
mit denen heuchelt, die dieses Verbrechen begehen, ihm geht es einzig
und allein um die Opfer. Doch dieser Band funktioniert noch auf zwei
weiteren Ebenen: Zunächst ist er eine Hommage an Talbots Heimat,
eine der schönsten Landschaften Europas, gleichzeitig ist er eine
Huldigung für Beatrix Potter, Autorin und Zeichnerin so vieler
klassischer britischer Kinderbücher. Denn Potter, die sich nicht
durch Zufall mit Talbots Heldin den Nachnamen teilt, war auch für
andere Menschen schwer zugänglich, den Grund dafür erfuhr
man niemals. Talbot, ein Zeichner aus der Ecke des britischen Magazins
"2000 A.D." und daher ansonsten eher dem SF-/Fantasy-Genre
zugeneigt, hat in der "Geschichte einer bösen Ratte"
ein Buch geschaffen, das ganz im Heute verwurzelt ist. Doch seine Erzählweise,
seine Verwendung von Farben, Licht und Lay-Outs im Sinne der Story,
sein dicht gewobener Plot und die kluge Verwendung von Rückblenden,
ist fast schon beispielhaft zu nennen. Ein ebenso schönes, wie
wichtiges Buch. (LuG)
|
|
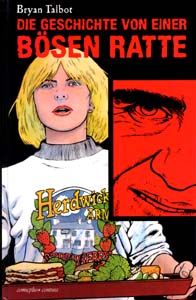 |
|
 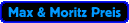 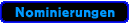
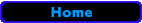
|
![]()